PD Dr. Elke Maurer
Dr. Carmen Heinz
Dr. Franziska Zwecker
Dr. Bela Braag
Axel Lust
Dr. Nicolas Gumpert
Fachärzte für Orthopädie
Privatpraxis
für Orthopädie, Sportmedizin, ärztliche Osteopathie, Akupunktur und manuelle Medizin
direkt am Kaiserplatz
Kaiserstraße 14/Eingang Kirchnerstraße 2
60311 Frankfurt am Main
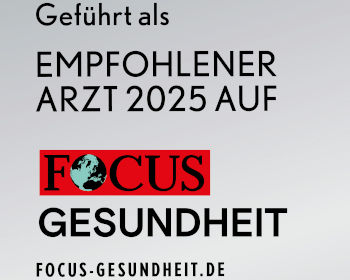

Dieser Artikel wurde zuletzt durch Axel Lust überarbeitet.
Axel Lust ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und ist bei Lumedis unser Spezialist für die Wirbelsäule.
Er hat sich auf die Behandlung der verschiedenen Erkrankungen der Wirbelsäule ohne OP spezialisiert.
Gerne berät Sie unser Spezialist in seiner Wirbelsäulen-Sprechstunde.
Die Spondylodiszitis ist eine seltene, aber ernstzunehmende Entzündung der Bandscheiben (Diszitis) und der angrenzenden Wirbelkörper (Spondylitis). Sie wird in den meisten Fällen durch eine Infektion mit Bakterien oder seltener durch Pilze verursacht. Die Erkrankung kann starke Rückenschmerzen auslösen und ohne frühzeitige Behandlung zu schweren Komplikationen wie Abszessen oder Wirbelkörperinstabilität führen.

Die Spondylodiszitis entsteht meist durch eine Infektion, die sich über den Blutkreislauf oder eine direkte Keimbesiedelung der Wirbelsäule entwickelt. Zu den häufigsten Ursachen gehören:
Die Erkrankung äußert sich oft schleichend mit zunehmenden Beschwerden. Typische Anzeichen sind starke und anhaltende Rückenschmerzen, welche sowohl in Ruhe als auch bei Bewegung auftreten können. Zudem kommt es zu begleitenden Infektionszeichen wie Fieber und Schüttelfrost. Durch die Infektion fühlen sich viele Patienten kraftlos und erschöpft. Falls die Entzündung auf das Rückenmark drückt, können Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühle oder Blasen- und Darmentleerungsstörungen auftreten. Bei chronischen Infektionen wie einer anhaltenden Spondylodiszitis kann es zu ungewolltem Gewichtsverlust kommen.
Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus Anamnese, körperlicher Untersuchung und bildgebenden Verfahren. Zunächst wird der Verdacht durch eine ausführliche Befragung zur Schmerzsymptomatik und möglichen Infektionen weiter abgeklärt. Anschließend erfolgt eine Blutuntersuchung, um Entzündungswerte zu bestimmen. Bildgebende Verfahren wie eine Röntgenaufnahme oder ein MRT der Wirbelsäule helfen dabei, die Entzündung sichtbar zu machen.
Typischerweise sind die Entzündungswerte im Blut deutlich erhöht. Dazu gehören eine Erhöhung des C-reaktiven Proteins (CRP), sowie eine beschleunigte Blutsenkungsgeschwindigkeit. Auch eine erhöhte Leukozytenzahl, als die Zahl der weißen Blutkörperchen, weist auf eine bakterielle Infektion hin. Βei Verdacht auf eine bakterielle Infektion sollte immer eine Blutkultur oder mehrere mit abgenommen werden, damit Erreger im Blut nachgewiesen werden können. Das Wissen über den spezifischen Erreger ist wichtig für die antibiotische Behandlung.
Ein MRT wird dann durchgeführt, wenn eine Spondylodiszitis vermutet wird, aber andere bildgebende Verfahren keine eindeutige Diagnose ermöglichen. Besonders in frühen Krankheitsstadien ist ein MRT wichtig, da es Entzündungen der Bandscheiben und Weichteilveränderungen genauer darstellt als eine Röntgenaufnahme oder ein CT.
Die Therapie richtet sich nach der Ursache und dem Schweregrad der Erkrankung. In der Regel erfolgt eine Kombination aus medikamentöser Behandlung mit Antibiose und Fiebersenkung, physikalischer Therapie und in schweren Fällen operativen Eingriffen.
Da die Spondylodiszitis meist durch Bakterien verursacht wird, ist eine gezielte Antibiotikatherapie die wichtigste Behandlung. Die Gabe erfolgt zunächst intravenös über mehrere Wochen, anschließend kann auf Tabletten umgestellt werden. Wichtig ist eine ausreichende Therapiedauer, um ein Wiederaufflammen der Infektion zu verhindern. Dabei ist auch wichtig, dass die Patienten auch nach der stationären Behandlung die Antibiose weiterhin oral einnehmen. Die geeignete Antibiose richtet sich nach einem vom Labor erstellten Antibiogramm, welches sensible und resistente Antibiotika anziegt.
Eine Operation wird notwendig, wenn die Entzündung zu einer Instabilität der Wirbelsäule führt oder im Verlauf Abszesse entstehen, die nicht auf Antibiotika ansprechen. Zudem sollte operiert werden, wenn neurologische Ausfälle wie Lähmungen auftreten oder weiterhin starke Schmerzen trotz konservativer Therapie bestehen.
Mit einer frühzeitigen und konsequenten Behandlung sind die Heilungschancen gut. Allerdings kann die Genesung mehrere Monate dauern, da sich entzündete Gewebe und geschädigte Bandscheiben nur langsam regenerieren. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann es zu schweren Komplikationen wie einer Wirbelkörperzerstörung oder einer Sepsis kommen.
Da eine Spondylodiszitis eine langwierige Erkrankung ist, ist eine längere Arbeitsunfähigkeit üblich. In den meisten Fällen sind mehrere Wochen bis Monate Krankschreibung erforderlich, besonders wenn eine körperlich belastende Tätigkeit ausgeübt wird.
Die Erkrankung selbst ist nicht direkt ansteckend, da sie durch eine Infektion im Körper des Betroffenen entsteht. Allerdings können die zugrunde liegenden Erreger, insbesondere bei offenen Wunden oder Abszessen, theoretisch auf andere Menschen übertragen werden.
Wir setzen die Muskelfunktionsanalyse als wichtigen Bestandteil der Nachbehandlung einer Spondylodiszitis ein, um gezielt herauszufinden, welche Muskeln geschwächt oder verspannt sind. Durch verschiedene Tests kann der können wir erkennen, welche Muskelgruppen gestärkt oder mobilisiert werden müssen, um eine bestmögliche Rehabilitation zu ermöglichen. Eine erste Methode ist die Testung der Rumpfstabilität. Dabei wird überprüft, wie gut die tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur arbeitet, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Dies geschieht beispielsweise, indem die betroffene Person in Rückenlage liegt und versucht, ein Bein anzuheben, ohne dass sich der untere Rücken vom Boden abhebt. Wenn dies schwerfällt oder der Rücken ins Hohlkreuz gerät, zeigt dies eine Schwäche der stabilisierenden Muskulatur an. Eine weitere wichtige Untersuchung ist die Analyse der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Hierbei wird getestet, ob es durch die Erkrankung zu einer Versteifung oder Einschränkung in bestimmten Bereichen gekommen ist.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Bildmaterial unterstützen würden, was wir anonym auf Lumedis veröffentlichen dürfen.
Bitte räumen Sie uns in der Mail ein Nutzungsrecht ein, das Sie jederzeit wieder zurückziehen können.
Von Röntgenbildern / MRT´s / CT´s - wenn möglich die Originalbilder in großer Auflösung (bitte keine Bildschirmfotografien) schicken.
Damit helfen Sie anderen Ihre Erkrankung besser zu verstehen und einzuschätzen.
Bild bitte an info@lumedis.de.
Danke und viele Grüße
Ihr
Nicolas Gumpert
Wir beraten Sie gerne in unserer Wirbelsäulensprechstunde!